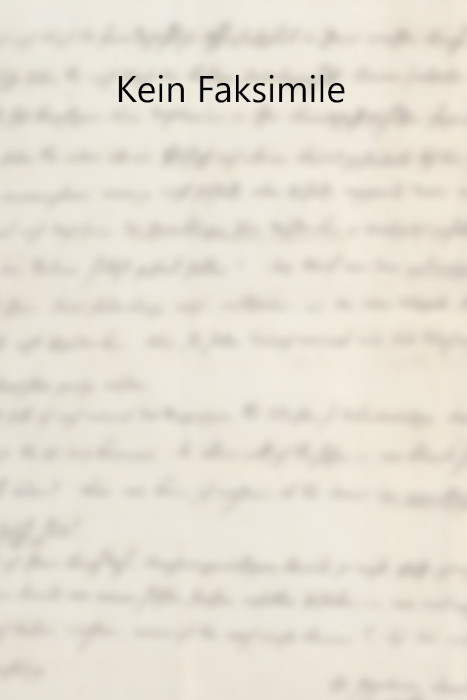
Jena, den 3. Oktober 1801.
Unsere Differenzpunkte, verehrtester Freund, in meinem Brief sammt und sonders auseinander zu setzen, und bis auf die erste Differenz, von der sie herstammen, Punkt für Punkt zurück zu verfolgen, möchte fast unmöglich seyn. Ich begnüge mich daher, vorzüglich nur einige Mißverständnisse und Vorurtheile, in denen Sie, Ihrem letzten Schreiben nach zu urtheilen, unfehlbar befangen sind, aufzulösen und fasse mich in einige wenige Sätze zusammen, nachdem der Vorsatz, ausführlicher zu seyn, bis jetzt nichts als das stete Verschieben meiner Antwort zur unvermeidlichen Folge gehabt hat.
Die Identität des Ideal= und Realgrundes ist = der Identität des Denkens und Anschauens. Sie drücken [/] mit dieser Identität die höchste spekulative Idee aus, die Idee des Absoluten, dessen Anschauen im Denken, dessen Denken im Anschauen ist. (Zur Erläuterung berufe ich mich der Kürze halber auf Kants Kritik der Urtheikskraft §. 76 Anmerk.) Da diese absolute Identität des Denkens und Anschauens das höchste Princip ist, so ist sie, wirklich als absolute Indifferenz gedacht, nothwendig zugleich das höchste Seyn; anstatt daß das endliche und bedingte Seyn, (z. B. der einzelnen körperlichen Dinge) immer eine bestimmte Differenz des Denkens und Anschauens ausdrückt. Hier trüben sich Ideelles und Reelles wechselseitig. Die ungetrübte Indifferenz beider ist nur im Absoluten. Ich bitte, um auf dem kürzesten Weg zu der Anschauung dieser absoluten Indifferenz und des damit nothwendig und unmittelbar verbundenen höchsten Seyns zu gelangen, an den absoluten Raum zu denken, der eben die (wieder angeschaute) höchste Indifferenz der Idealität und Realität ist, die höchste Durchsichtigkeit, Klarheit, das reinste Seyn, das wir anschauen. – Ihnen ist Seyn durchaus gleichbedeutend mit Realität, ja wohl gar mit Wirklichkeit. Das Seyn κατ᾿ ἐξοχὴν aber hat keinen Gegensatz mehr, denn es ist die absolute Einheit des Ideellen und Reellen selbst.
Sie wollen nun aber schlechterdings, daß dieses höchste Seyn, was nicht mehr Realität, im Gegensatz [/] gegen Idealität ist, als reine Agilität, absolute Thätigkeit, gedacht werde. Allein es kann Ihnen unmöglich entgehen, daß absolute Thätigkeit = absolute Ruhe (= Seyn), daß also von dem wahren Absoluten so wenig ein Handeln prädicirt werden kann, als von dem absoluten Raum, seinem Universalbild (wie oben gezeigt worden), von dem man nur sagen kann, daß er ist, nimmermehr aber, daß er thätig sey. (Wenn Sie hiemit noch den umgekehrten Schluß verbinden, daß Dasjenige, von welchem ein Handeln wahrhaft prädicirt werden kann, eben deßwegen nicht das wahre Absolute seyn könne, so ist mir dieß sehr erwünscht.)
Dieses Absolute, behaupte ich in meiner „Darstellung,” existirt unter der Form der quantitativen Differenz (dieß ist die Anschauung, die immer eine bestimmte ist) im Einzelnen und der quantitativen Indifferenz (dieß ist das Denken) im Ganzen. (Als Einheit aufgefaßt, ist es also absolute Gleichheit des Denkens und Anschauens. In dem Denken ist so viel als in dem Anschauen und umgekehrt; eins dem andern adäquat.) Sie sagen etwas Aehnliches mit dem, was Ihre letzte Synthesis ist, – dem, was zugleich unbegreiflicher Realgrund der Getrenntheit der Einzelnen und Idealgrund der Einheit Aller ist. Sie erheben sich also allerdings zu diesem Seyn, welches nicht Realität – nicht Wirklichkeit – sondern über allen Gegensatz von Ideellem und Reellem erhaben, [/] die absolute Identität davon ist. Aber dieses Seyn ist Ihnen die letzte Synthesis. Ich dächte aber, wenn sie wirklich zugleich die höchste ist, so ist sie eben darum das Absolute, das Unbedingte selbst, also unfehlbar zugleich das Erste, von dem ausgegangen werden muß.
Entweder müssen Sie nie aus dem Sehen, wie Sie sich ausdrücken, das heißt eben aus der Subjectivität heraus, und eines jeden Ich, wie Sie einmal in der Wissenschaftslehre sagen, muß die absolute Substanz seyn und bleiben, oder gehn Sie einmal heraus, auf Einen auch unbegreiflichen Realgrund, so gilt jenes ganze Zurückweisen an die Subjectivität nur vorläufig, bis das wahre Princip gefunden ist; und ich weiß nicht, wie Sie sich erwehren wollen, wenn, nachdem Sie bei jener Synthesis angekommen sind, Andere herzutreten, die nun diese als das Erste behandelnd, den Weg in der umgekehrten Richtung zurücklegen, Ihr Princip bloß für vorläufig und Ihre Philosophie eben so wie die Kantische für bloß propädeutisch erklären. Denn propädeutisch ist doch wohl eine Untersuchung, in der das höchste Princip Resultat, letzte Synthesis, ist. Verzeihen Sie, wenn ich diesen Schritt voraus genommen, und ohne Sie bei diesem Punkt abzuwarten, zu bestimmen gewagt habe, was, sobald Sie dabei angekommen sind, unvermeidlich seyn wird.
Sie selbst, indem Sie sagen: „wir möchten wohl, [/] was die Sachen betrifft, ziemlich einig seyn, obwohl ganz verschieden in der Darstellung, — diese aber sey wesentlich,” legen dadurch deutlicher, als ich zu sagen vermöchte, an den Tag, daß man um Ihr System zu erhalten sich erst entschließen muß, vom Sehen auszugehen und mit dem Absoluten (dem eigentlich Spekulativen) zu enden, ungefähr so, wie in der Kantischen Philosophie das Moralgesetz zuerst und Gott zuletzt vorkommen muß, wenn das System halten soll. Die Nothwendigkeit, vom Sehen auszugehen, bannt Sie mit Ihrer Philosophie in eine durch und durch bedingte Reihe, in der vom Absoluten nichts mehr anzutreffen ist. Das Bewußtseyn oder Gefühl, das [Sie] selbst davon haben mußten, zwang Sie schon, in der „Bestimmung des Menschen” das Speculative, weil Sie es nämlich in Ihrem Wissen wirklich nicht finden konnten, in die Sphäre des Glaubens überzutragen, von dem meines Erachtens in der Philosophie so wenig die Rede seyn kann, als in der Geometrie. Sie erklärten in derselben Schrift, fast mit so viel Worten: das eigentlich Ur=Reale, d. h. doch wohl das wahrhaft Speculative, sey im Wissen nirgends aufzuzeigen. Ist dieß nicht Beweises genug, daß Ihr Wissen nicht das absolute, sondern irgendwie noch bedingtes Wissen ist, welches die Philosophie, wenn es in ihr herrschend seyn müßte, zu einer Wissenschaft, wie jede andere herabsetzen würde. [/]
Was jetzt Ihre höchste Synthesis ist, war wenigstens Ihren früheren Darstellungen fremd, denn nach diesen war die moralische Weltordnung (ohne Zweifel das, was Sie jetzt reale Getrenntheit der Einzelnen und ideale Einheit Aller nennen) selbst Gott; dieß ist jetzt, wenn ich recht sehe, nicht mehr der Fall und dieß verändert die ganze Sache Ihrer Philosophie um ein Beträchtliches.
Dieß Alles, was ich als Spur Ihres Annäherns vom bloßen Philosophiren zur wahren Speculation betrachte, giebt auch mir die Hoffnung und Freudigkeit, wir werden uns endlich ganz in dem Punkte begegnen, der, nach Ihrer bisherigen Methode Ihnen nothwendig mehr oder weniger entfliehen mußte, und der auch durch ein stufenweises Aufsteigen von unten nie erreicht, sondern nur mit Einemmal und auf absolute Art gefaßt werden kann.
Sie scheinen in Ihrem letzten Brief zurückzunehmen, was Sie in Ihrem früheren zugaben, oder gar zu bezweifeln, ob Sie es wirklich geschrieben haben. Vielleicht ist es aus diesem Grund nicht unzweckmäßig, die Stelle, auf welche es ankommt, Ihnen wörtlich mitzutheilen.
„Zu verstehen glaube ich Sie recht wohl,” schreiben Sie, „und verstand Sie schon vorher, nur glaube ich nicht, daß diese Sätze aus den bisherigen Principien des Transscendentalismus folgen, sondern ihnen [/] vielmehr entgegen sind; daß sie nur durch eine weitere Ausdehnung der Transscendentalphilosophie selbst in ihren Principien begründet werden können, zu welcher ohnedieß das Zeitbedürfniß aufs Dringendste auffordert.”
Hierauf melden Sie nun, daß nach Vollendung der neuen Darstellung der Wissenschaftslehre diese Erweiterung Ihr erstes Geschäft seyn werde.
Ihr Gesichtspunkt bringt es so mit sich, daß Ihnen Ihre Philosophie als die absolut=wahre erscheinen muß bloß darum, weil sie nur nicht falsch ist. Spinoza setzt als die beiden Attribute der Substanz Gedanke und Ausdehnung. Er läugnet nicht, daß Alles, was ist, auch aus dem bloßen Attribut des Denkens und durch bloße Modos des unendlichen Denkens erklärt werden könne. Diese Erklärungsart würde er gar nicht falsch, er würde sie nur nicht absolut=wahr, sondern in der absoluten selbst begriffen finden. Etwas Aehnliches findet zwischen uns statt; woraus [Sie] unter Anderm auch sich erklären können, warum unserer Differenz im Grunde und von Anfang an unerachtet, ich gleichwohl habe den Idealismus als Organ brauchen, ja, wie Sie sagen, so viel Klares, Tiefes sogar darüber vorbringen können.
Sie geben dem Realgrund der Getrenntheit des Einzelnen den Beisatz: unbegreiflich. Unbegreiflich ist er freilich für die von unten aufsteigende Verstandes[/]reflexion, die sich mit dem Gegensatz des Endlichen (Ihre Getrenntheit) und Unendlichen (Ihre Einheit Aller) in unauflösliche Widersprüche verwickelt (Kants Antinomien), nicht aber für die Vernunft, welche die absolute Identität, das untrennbare Beisammenseyn des Endlichen mit dem Unendlichen, als das Erste setzt und von dem Ewigen ausgeht, welches weder endlich noch unendlich, sondern beides gleich ewig ist. Diese Vernunftewigkeit ist das eigentliche Princip aller Speculation und des wahren Idealismus, das Vernichtende der Causalreihe des Endlichen, der sie dem Wesen nach (natura) in jedem Augenblick der Zeit ebenso vorangeht, als sie ihr ursprünglich voranging, so wie sie umgekehrt niemals auf eine andere Weise vor ihr war, als sie noch jetzt und immer ist, nämlich der Natur nach.
Sie müssen mir verzeihen, wenn ich sage, daß durch Ihr ganzes Schreiben ein völliges Mißverständniß meiner Ideen geht, das sehr natürlich ist, da Sie sich eben nicht bekümmert haben, sie wirklich kennen zu lernen. Dagegen ist von allen Ideen, die Sie in Ihrem Schreiben mir mitzutheilen die Güte haben, keine, die mir fremd wäre. Ich kenne auch, wie Sie mir vielleicht zugestehen werden, zum Theil aus eigenem Gebrauch alle die Künste, mit welchen der Idealismus als das einzig nothwendige System demonstrirt wird. Diese [/] Künste, die gegen alle Ihre bisherigen Gegner treffend waren, sind gegen mich von keiner Wirkung, da ich nicht Ihr Gegner bin, obwohl Sie aller Wahrscheinlichkeit nach der meinige sind. Ich habe schon oben gesagt, daß ich Ihr System nicht falsch finde, denn es ist ein nothwendiger und integranter Theil des meinigen.
Sehr zu wünschen wäre, Sie hätten immer und zu jeder Zeit befolgt, was Sie in Ihrem letzten Brief aussprechen: „was Idealismus und Realismus sey, kann nur innerhalb der Wissenschaftslehre untersucht werden.” (Es folgt unmittelbar daraus, daß die wahre Wissenschaftslehre, d. h. die ächte speculative Philosophie so wenig Idealismus als Realismus seyn könne. Haben Sie aber Ihre Philosophie nicht bestimmt genug als Idealismus charakterisirt?) Sie würden dann sich leichter auch in meinen Satz vereinigen können, daß das ächte System der Philosophie nach außen völlig indifferent, obwohl nach innen different seyn könne. Dieser Begriff der absoluten Indifferenz des wahren Systems nach außen, war allein hinreichend, Ihnen die Vorstellung von dem meinigen, als statuire es zwei neben einander bestehende Philosophien, zu ersparen.
Ich mag mich wohl in den Briefen über Dogmatismus und Kriticismus, in dem ersten noch rohen und unentwickelten Gefühl, daß die Wahrheit höher liege, [/] als der Idealismus geht, unbeholfen genug ausgedrückt haben; indeß kann ich mich auf diese Briefe als ein sehr frühes Dokument des Gefühles berufen, das bei Ihnen auf Veranlassung der atheistischen Streitigkeiten nicht weniger zum Vorschein kam, und Sie zwang, das im Wissen (d. h. eben im Idealismus) vermißte Urreale (Speculative) aus dem Glauben herzuholen. Meine idealistische und realistische Philosophie verhalten sich also gerade und genau so, wie Ihr Wissen und Glauben, deren Gegensatz Sie noch überdieß völlig unaufgehoben zurückließen, und wenn Sie dort an mir irre wurden, so habe ich dagegen hier aufgehört, Ihnen folgen zu können.
Diese Briefe ließen Sie freilich gleich sehen, „daß ich die Wissenschaftslehre nicht durchdrungen habe.” Dieß kann nun um so eher der Fall gewesen seyn, da ich, als jene Briefe entstanden, von der Wissenschaftslehre in der That nur die ersten Bogen kannte. Aber freilich habe ich sie in diesem Sinn bis jetzt nicht durchdrungen, noch bin ich gesonnen, sie in diesem Sinn jemals zu durchdringen, nämlich so, daß ich bei dieser Durchdringung der Durchdrungene sey. Diese Meinung habe ich von der Wissenschaftslehre nie gehabt, und habe sie also noch viel weniger jetzt, daß ich sie als das Buch betrachtete, worauf nun fernerhin jeder im Philosophiren angewiesen wäre und angewiesen werden [/] müßte, obgleich freilich das Urtheil in philosophischen Dingen um ein Beträchtliches erleichtert wäre, wenn es dazu bloß eines ausgestellten Testimoniums des Verstehens oder Nichtverstehens derselben von Ihnen bedürfte.
Wenn ich gegen Jemand behaupte: Im alten Testament sind Mythen und er antwortete darauf: Wie sollte das seyn, da es ja die Einheit Gottes lehrt, wäre es meine Schuld, wenn dieser das Wort „Mythologie” nicht hören könnte, ohne damit den trivialen Begriff der Götterlehre zu verbinden? Fast so geht es mir bei Vielen mit dem Begriff „Naturphilosophie.” Kann ich dafür, wenn man mir keinen andern Begriff der Natur zuschreibt, als den jeder Chemiker und Apotheker auch hat? Aber Fichte, der noch ganz andere Waffen gegen mich hat, macht es sich allzuleicht, wenn er mich aus einem solchen Begriff zu widerlegen, nur würdigt. Um so mehr wundere ich mich, daß Sie sich von Naturphilosophie einen so willkührlichen Begriff machen, da Sie ja selbst bekennen, daß diese Seite meines Systems eine Ihnen noch völlig unbekannte Region ist. Sie sagen „die Sinnenwelt, oder (??) die Natur ist durchaus nichts als Erscheinung des immanenten Lichtes.” Ist es möglich, dachte ich, als ich dieß las, daß es Fichten nicht einfallen kann, eben dieß zu beweisen, könnte Zweck der Naturphilosophie seyn. – Wie leid ist [/] es mir, daß Sie sich davon nicht durch die Lectüre meiner letzten Darstellung haben überzeugen wollen!
Nicht undeutlich sind Sie der Meinung, durch Ihr System die Natur annihilirt zu haben, da Sie vielmehr mit dem größten Theil desselben nie aus der Natur herauskommen. Ob ich die Reihe des Bedingten reell oder ideell mache, ist, speculativ betrachtet, völlig gleichgültig, denn in dem Einen Falle so wenig wie in dem andern, komme ich aus dem Endlichen heraus. Sie glaubten durch das Letztere die ganze Forderung der Spekulation erfüllt zu haben; und hier ist ein Hauptpunkt unserer Differenz.
Von dem dritten Grundsatz an, mit dem Sie in die Sphäre der Theilbarkeit, der wechselseitigen Limitation d. h. des Endlichen gelangen, ist Ihnen Philosophie eine stete Reihe von Endlichkeiten – eine höhere Kausalitätsreihe. Die wahre Annihilation der Natur (in Ihrem Sinn) kann nicht darin bestehen, daß man sie nur im ideellen Sinn gleichwohl reell seyn läßt, sondern nur darin, daß man das Endliche zu der absoluten Identität mit dem Unendlichen bringt, das heißt, daß man außer dem Ewigen nichts, und das Endliche so wenig im reellen (gemeinen) Sinn, als im ideellen (Ihrem) Sinn zugiebt.
In welche kleine Region des Bewußtseyns Ihnen die Natur nach Ihrem Begriff davon fallen müsse, ist [/] mir zur Genüge bekannt. Sie hat Ihnen durchaus keine speculative, sondern nur teleologische Bedeutung. Sollten Sie aber wirklich z. B. der Meinung seyn, daß das Licht nur ist, damit die Vernunftwesen, indem sie miteinander sprechen, sich auch sehen, und die Luft, damit sie, indem sie einander hören, mit einander sprechen können?
Ueber das, was Sie weiter von einem Idealismus, der einen Realismus neben sich duldet, erwähnen, habe ich nichts zu bemerken, als daß Sie damit in dem hauptsächlichsten Mißverständniß über mich begriffen sind, welches in einem Brief aufzulösen, viel zu weitläufig ist, um so mehr, da ich hierüber nur auf meine letzte Darstellung verweisen darf. Sollte diese nicht hinreichend seyn, so muß ich meine Hoffnung auf die künftigen Erläuterungen über diesen Hauptpunkt zwischen Ihnen und mir setzen.
Binnen Kurzem erhalten Sie ein philosophisches Gespräch von mir, von dem ich wünsche, daß Sie es lesen. Die Fortsetzung meiner Darstellung wird auch binnen dieses und des künftigen Monats erscheinen. [/]
Ich von meiner Seite werde mich alles entscheidenden Urtheils über Ihr gesammtes System so lange enthalten, bis die neue Darstellung erschienen ist. Dieß versteht sich von selbst. Ebenso erwarte ich von Ihnen, daß Sie die Vollendung meiner Darstellung abwarten, und daß Sie diese wirklich lesen, ehe Sie ein Urtheil darüber fassen und aussprechen. Vor dem Publikum würden solche Wendungen, wie: So weit ich in Ihrer Darstellung gelesen habe ec. eben nicht die beste Wirkung thun.
Sollte aber der Wunsch, daß die Differenzen zwischen uns weiter nicht laut werden, so gemeint seyn, daß ich damit nur so lange warte, bis es Ihnen gelegen ist, sie laut werden zu lassen, oder daß ich Ihnen indeß erlaube, in Ankündigungen der neuen Wissenschaftslehre u.s.w. mich als Ihren geistvollen Mitarbeiter zu rühmen, dabei aber dem Publikum auf eine feine und versteckte Weise, daß es auch die Nicolais und Recensenten der Allg. D. B. merken, unter die Füße zu geben, daß ich Sie nicht verstehe, so sehen Sie wohl, daß dieser Vorschlag etwas unbillig ist.
Daß meine Philosophie eine andere ist, als die Ihrige, betrachte ich als ein sehr geringes Uebel, das ich zur Noth noch ertragen kann. Aber die Ihrige haben darstellen wollen, und auch darin nicht einmal glücklich gewesen zu seyn – lieber Fichte, dieß ist wirklich etwas [/] zu hart, besonders da wenn das Erste ausgemacht ist, über das zweite Ihr Wort ohne alle Gründe hinreicht. Wollen Sie also auch nicht förmliche Erklärung der Differenz, so erzeigen Sie mir wenigstens nicht die schon bei Ihrer letzten Ankündigung meinerseits völlig unverdiente Güte, mich als Ihren Mitarbeiter anzunehmen; denn jene Annahme vor dem Publikum fällt in eine Zeit, wo Sie für sich bereits zur Genüge wissen konnten, daß ich nicht einen und denselben Zweck mit Ihnen habe.
Ruhig über das Ende und meiner Sache für mich gewiß, überlasse ich vorläufig gern einem jeden selbst, unser Verhältniß herauszufinden; ich kann aber auch keinem seine gesunden Augen nehmen oder es auf irgend eine Weise zu bemänteln suchen. So ist erst dieser Tage ein Buch von einem sehr vorzüglichen Kopf erschienen, das zum Titel hat: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, an dem ich keinen Antheil habe, das ich aber auch auf keine Weise verhindern konnte.
Den „sonnenklaren Beweis” haben Sie vergessen, beizulegen. Ich habe ihn aber gleichwohl in Händen gehabt. Der Idealismus darin schien mir ziemlich psychologisch, fast wie in Lichtenbergs nachgelassenen Schriften: auch hat es mir leid gethan, daß Sie unter den Beschäftigungen für abgängige Philosophen auch das Brillenschleifen vorschlagen, das bekanntlich Spinoza [/] stark getrieben hat, der obwohl er sich außer der Philosophie noch mit einigen andern Dingen beschäftigte, dennoch ein sehr großer Philosoph war.
Leben Sie wohl und bleiben Sie mir gewogen. Mit der aufrichtigsten Verehrung und den redlichsten Gesinnungen
der Ihrige
Schelling.
Unsere Differenzpunkte, verehrtester Freund, in meinem Brief sammt und sonders auseinander zu setzen, und bis auf die erste Differenz, von der sie herstammen, Punkt für Punkt zurück zu verfolgen, möchte fast unmöglich seyn. Ich begnüge mich daher, vorzüglich nur einige Mißverständnisse und Vorurtheile, in denen Sie, Ihrem letzten Schreiben nach zu urtheilen, unfehlbar befangen sind, aufzulösen und fasse mich in einige wenige Sätze zusammen, nachdem der Vorsatz, ausführlicher zu seyn, bis jetzt nichts als das stete Verschieben meiner Antwort zur unvermeidlichen Folge gehabt hat.
Die Identität des Ideal= und Realgrundes ist = der Identität des Denkens und Anschauens. Sie drücken [/] mit dieser Identität die höchste spekulative Idee aus, die Idee des Absoluten, dessen Anschauen im Denken, dessen Denken im Anschauen ist. (Zur Erläuterung berufe ich mich der Kürze halber auf Kants Kritik der Urtheikskraft §. 76 Anmerk.) Da diese absolute Identität des Denkens und Anschauens das höchste Princip ist, so ist sie, wirklich als absolute Indifferenz gedacht, nothwendig zugleich das höchste Seyn; anstatt daß das endliche und bedingte Seyn, (z. B. der einzelnen körperlichen Dinge) immer eine bestimmte Differenz des Denkens und Anschauens ausdrückt. Hier trüben sich Ideelles und Reelles wechselseitig. Die ungetrübte Indifferenz beider ist nur im Absoluten. Ich bitte, um auf dem kürzesten Weg zu der Anschauung dieser absoluten Indifferenz und des damit nothwendig und unmittelbar verbundenen höchsten Seyns zu gelangen, an den absoluten Raum zu denken, der eben die (wieder angeschaute) höchste Indifferenz der Idealität und Realität ist, die höchste Durchsichtigkeit, Klarheit, das reinste Seyn, das wir anschauen. – Ihnen ist Seyn durchaus gleichbedeutend mit Realität, ja wohl gar mit Wirklichkeit. Das Seyn κατ᾿ ἐξοχὴν aber hat keinen Gegensatz mehr, denn es ist die absolute Einheit des Ideellen und Reellen selbst.
Sie wollen nun aber schlechterdings, daß dieses höchste Seyn, was nicht mehr Realität, im Gegensatz [/] gegen Idealität ist, als reine Agilität, absolute Thätigkeit, gedacht werde. Allein es kann Ihnen unmöglich entgehen, daß absolute Thätigkeit = absolute Ruhe (= Seyn), daß also von dem wahren Absoluten so wenig ein Handeln prädicirt werden kann, als von dem absoluten Raum, seinem Universalbild (wie oben gezeigt worden), von dem man nur sagen kann, daß er ist, nimmermehr aber, daß er thätig sey. (Wenn Sie hiemit noch den umgekehrten Schluß verbinden, daß Dasjenige, von welchem ein Handeln wahrhaft prädicirt werden kann, eben deßwegen nicht das wahre Absolute seyn könne, so ist mir dieß sehr erwünscht.)
Dieses Absolute, behaupte ich in meiner „Darstellung,” existirt unter der Form der quantitativen Differenz (dieß ist die Anschauung, die immer eine bestimmte ist) im Einzelnen und der quantitativen Indifferenz (dieß ist das Denken) im Ganzen. (Als Einheit aufgefaßt, ist es also absolute Gleichheit des Denkens und Anschauens. In dem Denken ist so viel als in dem Anschauen und umgekehrt; eins dem andern adäquat.) Sie sagen etwas Aehnliches mit dem, was Ihre letzte Synthesis ist, – dem, was zugleich unbegreiflicher Realgrund der Getrenntheit der Einzelnen und Idealgrund der Einheit Aller ist. Sie erheben sich also allerdings zu diesem Seyn, welches nicht Realität – nicht Wirklichkeit – sondern über allen Gegensatz von Ideellem und Reellem erhaben, [/] die absolute Identität davon ist. Aber dieses Seyn ist Ihnen die letzte Synthesis. Ich dächte aber, wenn sie wirklich zugleich die höchste ist, so ist sie eben darum das Absolute, das Unbedingte selbst, also unfehlbar zugleich das Erste, von dem ausgegangen werden muß.
Entweder müssen Sie nie aus dem Sehen, wie Sie sich ausdrücken, das heißt eben aus der Subjectivität heraus, und eines jeden Ich, wie Sie einmal in der Wissenschaftslehre sagen, muß die absolute Substanz seyn und bleiben, oder gehn Sie einmal heraus, auf Einen auch unbegreiflichen Realgrund, so gilt jenes ganze Zurückweisen an die Subjectivität nur vorläufig, bis das wahre Princip gefunden ist; und ich weiß nicht, wie Sie sich erwehren wollen, wenn, nachdem Sie bei jener Synthesis angekommen sind, Andere herzutreten, die nun diese als das Erste behandelnd, den Weg in der umgekehrten Richtung zurücklegen, Ihr Princip bloß für vorläufig und Ihre Philosophie eben so wie die Kantische für bloß propädeutisch erklären. Denn propädeutisch ist doch wohl eine Untersuchung, in der das höchste Princip Resultat, letzte Synthesis, ist. Verzeihen Sie, wenn ich diesen Schritt voraus genommen, und ohne Sie bei diesem Punkt abzuwarten, zu bestimmen gewagt habe, was, sobald Sie dabei angekommen sind, unvermeidlich seyn wird.
Sie selbst, indem Sie sagen: „wir möchten wohl, [/] was die Sachen betrifft, ziemlich einig seyn, obwohl ganz verschieden in der Darstellung, — diese aber sey wesentlich,” legen dadurch deutlicher, als ich zu sagen vermöchte, an den Tag, daß man um Ihr System zu erhalten sich erst entschließen muß, vom Sehen auszugehen und mit dem Absoluten (dem eigentlich Spekulativen) zu enden, ungefähr so, wie in der Kantischen Philosophie das Moralgesetz zuerst und Gott zuletzt vorkommen muß, wenn das System halten soll. Die Nothwendigkeit, vom Sehen auszugehen, bannt Sie mit Ihrer Philosophie in eine durch und durch bedingte Reihe, in der vom Absoluten nichts mehr anzutreffen ist. Das Bewußtseyn oder Gefühl, das [Sie] selbst davon haben mußten, zwang Sie schon, in der „Bestimmung des Menschen” das Speculative, weil Sie es nämlich in Ihrem Wissen wirklich nicht finden konnten, in die Sphäre des Glaubens überzutragen, von dem meines Erachtens in der Philosophie so wenig die Rede seyn kann, als in der Geometrie. Sie erklärten in derselben Schrift, fast mit so viel Worten: das eigentlich Ur=Reale, d. h. doch wohl das wahrhaft Speculative, sey im Wissen nirgends aufzuzeigen. Ist dieß nicht Beweises genug, daß Ihr Wissen nicht das absolute, sondern irgendwie noch bedingtes Wissen ist, welches die Philosophie, wenn es in ihr herrschend seyn müßte, zu einer Wissenschaft, wie jede andere herabsetzen würde. [/]
Was jetzt Ihre höchste Synthesis ist, war wenigstens Ihren früheren Darstellungen fremd, denn nach diesen war die moralische Weltordnung (ohne Zweifel das, was Sie jetzt reale Getrenntheit der Einzelnen und ideale Einheit Aller nennen) selbst Gott; dieß ist jetzt, wenn ich recht sehe, nicht mehr der Fall und dieß verändert die ganze Sache Ihrer Philosophie um ein Beträchtliches.
Dieß Alles, was ich als Spur Ihres Annäherns vom bloßen Philosophiren zur wahren Speculation betrachte, giebt auch mir die Hoffnung und Freudigkeit, wir werden uns endlich ganz in dem Punkte begegnen, der, nach Ihrer bisherigen Methode Ihnen nothwendig mehr oder weniger entfliehen mußte, und der auch durch ein stufenweises Aufsteigen von unten nie erreicht, sondern nur mit Einemmal und auf absolute Art gefaßt werden kann.
Sie scheinen in Ihrem letzten Brief zurückzunehmen, was Sie in Ihrem früheren zugaben, oder gar zu bezweifeln, ob Sie es wirklich geschrieben haben. Vielleicht ist es aus diesem Grund nicht unzweckmäßig, die Stelle, auf welche es ankommt, Ihnen wörtlich mitzutheilen.
„Zu verstehen glaube ich Sie recht wohl,” schreiben Sie, „und verstand Sie schon vorher, nur glaube ich nicht, daß diese Sätze aus den bisherigen Principien des Transscendentalismus folgen, sondern ihnen [/] vielmehr entgegen sind; daß sie nur durch eine weitere Ausdehnung der Transscendentalphilosophie selbst in ihren Principien begründet werden können, zu welcher ohnedieß das Zeitbedürfniß aufs Dringendste auffordert.”
Hierauf melden Sie nun, daß nach Vollendung der neuen Darstellung der Wissenschaftslehre diese Erweiterung Ihr erstes Geschäft seyn werde.
Ihr Gesichtspunkt bringt es so mit sich, daß Ihnen Ihre Philosophie als die absolut=wahre erscheinen muß bloß darum, weil sie nur nicht falsch ist. Spinoza setzt als die beiden Attribute der Substanz Gedanke und Ausdehnung. Er läugnet nicht, daß Alles, was ist, auch aus dem bloßen Attribut des Denkens und durch bloße Modos des unendlichen Denkens erklärt werden könne. Diese Erklärungsart würde er gar nicht falsch, er würde sie nur nicht absolut=wahr, sondern in der absoluten selbst begriffen finden. Etwas Aehnliches findet zwischen uns statt; woraus [Sie] unter Anderm auch sich erklären können, warum unserer Differenz im Grunde und von Anfang an unerachtet, ich gleichwohl habe den Idealismus als Organ brauchen, ja, wie Sie sagen, so viel Klares, Tiefes sogar darüber vorbringen können.
Sie geben dem Realgrund der Getrenntheit des Einzelnen den Beisatz: unbegreiflich. Unbegreiflich ist er freilich für die von unten aufsteigende Verstandes[/]reflexion, die sich mit dem Gegensatz des Endlichen (Ihre Getrenntheit) und Unendlichen (Ihre Einheit Aller) in unauflösliche Widersprüche verwickelt (Kants Antinomien), nicht aber für die Vernunft, welche die absolute Identität, das untrennbare Beisammenseyn des Endlichen mit dem Unendlichen, als das Erste setzt und von dem Ewigen ausgeht, welches weder endlich noch unendlich, sondern beides gleich ewig ist. Diese Vernunftewigkeit ist das eigentliche Princip aller Speculation und des wahren Idealismus, das Vernichtende der Causalreihe des Endlichen, der sie dem Wesen nach (natura) in jedem Augenblick der Zeit ebenso vorangeht, als sie ihr ursprünglich voranging, so wie sie umgekehrt niemals auf eine andere Weise vor ihr war, als sie noch jetzt und immer ist, nämlich der Natur nach.
Sie müssen mir verzeihen, wenn ich sage, daß durch Ihr ganzes Schreiben ein völliges Mißverständniß meiner Ideen geht, das sehr natürlich ist, da Sie sich eben nicht bekümmert haben, sie wirklich kennen zu lernen. Dagegen ist von allen Ideen, die Sie in Ihrem Schreiben mir mitzutheilen die Güte haben, keine, die mir fremd wäre. Ich kenne auch, wie Sie mir vielleicht zugestehen werden, zum Theil aus eigenem Gebrauch alle die Künste, mit welchen der Idealismus als das einzig nothwendige System demonstrirt wird. Diese [/] Künste, die gegen alle Ihre bisherigen Gegner treffend waren, sind gegen mich von keiner Wirkung, da ich nicht Ihr Gegner bin, obwohl Sie aller Wahrscheinlichkeit nach der meinige sind. Ich habe schon oben gesagt, daß ich Ihr System nicht falsch finde, denn es ist ein nothwendiger und integranter Theil des meinigen.
Sehr zu wünschen wäre, Sie hätten immer und zu jeder Zeit befolgt, was Sie in Ihrem letzten Brief aussprechen: „was Idealismus und Realismus sey, kann nur innerhalb der Wissenschaftslehre untersucht werden.” (Es folgt unmittelbar daraus, daß die wahre Wissenschaftslehre, d. h. die ächte speculative Philosophie so wenig Idealismus als Realismus seyn könne. Haben Sie aber Ihre Philosophie nicht bestimmt genug als Idealismus charakterisirt?) Sie würden dann sich leichter auch in meinen Satz vereinigen können, daß das ächte System der Philosophie nach außen völlig indifferent, obwohl nach innen different seyn könne. Dieser Begriff der absoluten Indifferenz des wahren Systems nach außen, war allein hinreichend, Ihnen die Vorstellung von dem meinigen, als statuire es zwei neben einander bestehende Philosophien, zu ersparen.
Ich mag mich wohl in den Briefen über Dogmatismus und Kriticismus, in dem ersten noch rohen und unentwickelten Gefühl, daß die Wahrheit höher liege, [/] als der Idealismus geht, unbeholfen genug ausgedrückt haben; indeß kann ich mich auf diese Briefe als ein sehr frühes Dokument des Gefühles berufen, das bei Ihnen auf Veranlassung der atheistischen Streitigkeiten nicht weniger zum Vorschein kam, und Sie zwang, das im Wissen (d. h. eben im Idealismus) vermißte Urreale (Speculative) aus dem Glauben herzuholen. Meine idealistische und realistische Philosophie verhalten sich also gerade und genau so, wie Ihr Wissen und Glauben, deren Gegensatz Sie noch überdieß völlig unaufgehoben zurückließen, und wenn Sie dort an mir irre wurden, so habe ich dagegen hier aufgehört, Ihnen folgen zu können.
Diese Briefe ließen Sie freilich gleich sehen, „daß ich die Wissenschaftslehre nicht durchdrungen habe.” Dieß kann nun um so eher der Fall gewesen seyn, da ich, als jene Briefe entstanden, von der Wissenschaftslehre in der That nur die ersten Bogen kannte. Aber freilich habe ich sie in diesem Sinn bis jetzt nicht durchdrungen, noch bin ich gesonnen, sie in diesem Sinn jemals zu durchdringen, nämlich so, daß ich bei dieser Durchdringung der Durchdrungene sey. Diese Meinung habe ich von der Wissenschaftslehre nie gehabt, und habe sie also noch viel weniger jetzt, daß ich sie als das Buch betrachtete, worauf nun fernerhin jeder im Philosophiren angewiesen wäre und angewiesen werden [/] müßte, obgleich freilich das Urtheil in philosophischen Dingen um ein Beträchtliches erleichtert wäre, wenn es dazu bloß eines ausgestellten Testimoniums des Verstehens oder Nichtverstehens derselben von Ihnen bedürfte.
Wenn ich gegen Jemand behaupte: Im alten Testament sind Mythen und er antwortete darauf: Wie sollte das seyn, da es ja die Einheit Gottes lehrt, wäre es meine Schuld, wenn dieser das Wort „Mythologie” nicht hören könnte, ohne damit den trivialen Begriff der Götterlehre zu verbinden? Fast so geht es mir bei Vielen mit dem Begriff „Naturphilosophie.” Kann ich dafür, wenn man mir keinen andern Begriff der Natur zuschreibt, als den jeder Chemiker und Apotheker auch hat? Aber Fichte, der noch ganz andere Waffen gegen mich hat, macht es sich allzuleicht, wenn er mich aus einem solchen Begriff zu widerlegen, nur würdigt. Um so mehr wundere ich mich, daß Sie sich von Naturphilosophie einen so willkührlichen Begriff machen, da Sie ja selbst bekennen, daß diese Seite meines Systems eine Ihnen noch völlig unbekannte Region ist. Sie sagen „die Sinnenwelt, oder (??) die Natur ist durchaus nichts als Erscheinung des immanenten Lichtes.” Ist es möglich, dachte ich, als ich dieß las, daß es Fichten nicht einfallen kann, eben dieß zu beweisen, könnte Zweck der Naturphilosophie seyn. – Wie leid ist [/] es mir, daß Sie sich davon nicht durch die Lectüre meiner letzten Darstellung haben überzeugen wollen!
Nicht undeutlich sind Sie der Meinung, durch Ihr System die Natur annihilirt zu haben, da Sie vielmehr mit dem größten Theil desselben nie aus der Natur herauskommen. Ob ich die Reihe des Bedingten reell oder ideell mache, ist, speculativ betrachtet, völlig gleichgültig, denn in dem Einen Falle so wenig wie in dem andern, komme ich aus dem Endlichen heraus. Sie glaubten durch das Letztere die ganze Forderung der Spekulation erfüllt zu haben; und hier ist ein Hauptpunkt unserer Differenz.
Von dem dritten Grundsatz an, mit dem Sie in die Sphäre der Theilbarkeit, der wechselseitigen Limitation d. h. des Endlichen gelangen, ist Ihnen Philosophie eine stete Reihe von Endlichkeiten – eine höhere Kausalitätsreihe. Die wahre Annihilation der Natur (in Ihrem Sinn) kann nicht darin bestehen, daß man sie nur im ideellen Sinn gleichwohl reell seyn läßt, sondern nur darin, daß man das Endliche zu der absoluten Identität mit dem Unendlichen bringt, das heißt, daß man außer dem Ewigen nichts, und das Endliche so wenig im reellen (gemeinen) Sinn, als im ideellen (Ihrem) Sinn zugiebt.
In welche kleine Region des Bewußtseyns Ihnen die Natur nach Ihrem Begriff davon fallen müsse, ist [/] mir zur Genüge bekannt. Sie hat Ihnen durchaus keine speculative, sondern nur teleologische Bedeutung. Sollten Sie aber wirklich z. B. der Meinung seyn, daß das Licht nur ist, damit die Vernunftwesen, indem sie miteinander sprechen, sich auch sehen, und die Luft, damit sie, indem sie einander hören, mit einander sprechen können?
Ueber das, was Sie weiter von einem Idealismus, der einen Realismus neben sich duldet, erwähnen, habe ich nichts zu bemerken, als daß Sie damit in dem hauptsächlichsten Mißverständniß über mich begriffen sind, welches in einem Brief aufzulösen, viel zu weitläufig ist, um so mehr, da ich hierüber nur auf meine letzte Darstellung verweisen darf. Sollte diese nicht hinreichend seyn, so muß ich meine Hoffnung auf die künftigen Erläuterungen über diesen Hauptpunkt zwischen Ihnen und mir setzen.
Binnen Kurzem erhalten Sie ein philosophisches Gespräch von mir, von dem ich wünsche, daß Sie es lesen. Die Fortsetzung meiner Darstellung wird auch binnen dieses und des künftigen Monats erscheinen. [/]
Ich von meiner Seite werde mich alles entscheidenden Urtheils über Ihr gesammtes System so lange enthalten, bis die neue Darstellung erschienen ist. Dieß versteht sich von selbst. Ebenso erwarte ich von Ihnen, daß Sie die Vollendung meiner Darstellung abwarten, und daß Sie diese wirklich lesen, ehe Sie ein Urtheil darüber fassen und aussprechen. Vor dem Publikum würden solche Wendungen, wie: So weit ich in Ihrer Darstellung gelesen habe ec. eben nicht die beste Wirkung thun.
Sollte aber der Wunsch, daß die Differenzen zwischen uns weiter nicht laut werden, so gemeint seyn, daß ich damit nur so lange warte, bis es Ihnen gelegen ist, sie laut werden zu lassen, oder daß ich Ihnen indeß erlaube, in Ankündigungen der neuen Wissenschaftslehre u.s.w. mich als Ihren geistvollen Mitarbeiter zu rühmen, dabei aber dem Publikum auf eine feine und versteckte Weise, daß es auch die Nicolais und Recensenten der Allg. D. B. merken, unter die Füße zu geben, daß ich Sie nicht verstehe, so sehen Sie wohl, daß dieser Vorschlag etwas unbillig ist.
Daß meine Philosophie eine andere ist, als die Ihrige, betrachte ich als ein sehr geringes Uebel, das ich zur Noth noch ertragen kann. Aber die Ihrige haben darstellen wollen, und auch darin nicht einmal glücklich gewesen zu seyn – lieber Fichte, dieß ist wirklich etwas [/] zu hart, besonders da wenn das Erste ausgemacht ist, über das zweite Ihr Wort ohne alle Gründe hinreicht. Wollen Sie also auch nicht förmliche Erklärung der Differenz, so erzeigen Sie mir wenigstens nicht die schon bei Ihrer letzten Ankündigung meinerseits völlig unverdiente Güte, mich als Ihren Mitarbeiter anzunehmen; denn jene Annahme vor dem Publikum fällt in eine Zeit, wo Sie für sich bereits zur Genüge wissen konnten, daß ich nicht einen und denselben Zweck mit Ihnen habe.
Ruhig über das Ende und meiner Sache für mich gewiß, überlasse ich vorläufig gern einem jeden selbst, unser Verhältniß herauszufinden; ich kann aber auch keinem seine gesunden Augen nehmen oder es auf irgend eine Weise zu bemänteln suchen. So ist erst dieser Tage ein Buch von einem sehr vorzüglichen Kopf erschienen, das zum Titel hat: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, an dem ich keinen Antheil habe, das ich aber auch auf keine Weise verhindern konnte.
Den „sonnenklaren Beweis” haben Sie vergessen, beizulegen. Ich habe ihn aber gleichwohl in Händen gehabt. Der Idealismus darin schien mir ziemlich psychologisch, fast wie in Lichtenbergs nachgelassenen Schriften: auch hat es mir leid gethan, daß Sie unter den Beschäftigungen für abgängige Philosophen auch das Brillenschleifen vorschlagen, das bekanntlich Spinoza [/] stark getrieben hat, der obwohl er sich außer der Philosophie noch mit einigen andern Dingen beschäftigte, dennoch ein sehr großer Philosoph war.
Leben Sie wohl und bleiben Sie mir gewogen. Mit der aufrichtigsten Verehrung und den redlichsten Gesinnungen
der Ihrige
Schelling.

