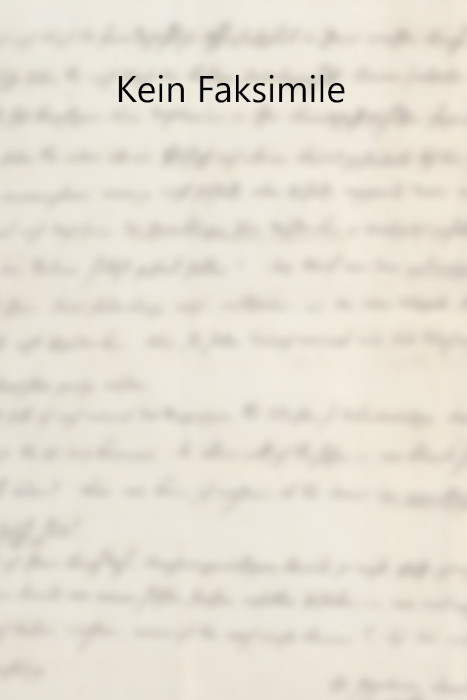
Berlin, d. 8br. 1801.
Es ist sehr wahr, daß durch Einen Brief es sich kaum bis zur Ueberzeugung wird erheben lassen, welcher von uns beiden es sey, der sich in erheblichen Irrthümern und Vorurtheilen befinde, und – denn dies würde der Fall seyn – flach philosophire. Die Wahrheiten, die Sie in Ihrem leztern vortragen, sind auch mir sehr wohl bekannt; alle Ihre Erklärungen über mich aber, und meine Meinungen gründen sich auf Verkennung und Herabsetzung meines StandPunktes.
Unsern DifferenzPunkt kann ich Ihnen mit wenigen Worten angeben. – „Das absolute“ (über welches, und dessen Bestimmung ich mit Ihnen völlig einverstanden bin, auch die Anschauung desselben seit langem besitze) „existirt unter der Form der quantitativen Differenz, behaupte ich in meiner Darstellung“ sagen Sie. Dies ist es freilich, was Sie behaupten; und gerade deswegen habe ich Ihr System irrig gefunden, und die Darstellung desselben – weil durch keine Folgerung, und Erörterung richtig werden kann, was im Princip nicht taugt – bei Seite gelegt. Eben so thut Spinoza, und überhaupt aller Dogmatismus, und dieses ist das πρωτον ψευδος [.] Das absolute wäre nicht das absolute, wenn es unter irgend einer Form existirte. Woher nun aber doch die Form – allerdings der Quantität, auch hierüber bin ich mit Ihnen einverstanden – unter der es erscheint, komme, wo eigentlich diese Form einheimisch sey – oder auch, wie denn das Eine erst zu einem Unendlichen, und dann zu einer Totalität des Mannigfaltigen werde, das ist die Frage, welche die bis zu Ende gekommene Spekulation zu lösen hat, und welche Sie, da Sie diese Form schon [/] am absoluten, und mit ihm zugleich finden, nothwendig ignoriren müssen. Hier nun, in einer Region sonach, die Sie durch Ihr neues System sich verschlossen haben, und die Ihnen, wie man erst nun mit Sicherheit sagen kann, nie bekannt war, liegt der Idealismus der Wissenschaftslehre, und der Kantische: keinesweges da tief unten, wo Sie ihn lociren.
Sollten Sie die Güte haben wollen, diesen Punkt, der Ihnen nicht entgehen kann, zu bedenken; und zugleich zu bedenken, wie es zuging, daß Sie ihn übersahen – (nemlich weil Sie an das Absolute unmittelbar mit Ihrem Denken gingen, ohne sich auf Ihr Denken, und daß es wohl nur dieses seyn möchte, was durch seine eignen immanenten Gesetze Ihnen unter der Hand das Absolute formirte, zu erinnern) – so würden Sie den wahren Idealismus bald kennen lernen, und einsehen, wie Sie mich fortdauernd misverstehen.
Ihr Schreiben hat noch einen zweiten Theil, dessen Berührung mir schmerzhaft ist. Wie kommt es doch, daß Sie sich nicht mittheilen können, ohne zu beleidigen, und daß Sie die Ihnen gegenüber so gern feige, und falsch denken mögen? Haben Sie doch die Güte, einmal aus meiner Lage heraus zu bedenken, wie ich in Absicht Ihrer mich verhalten sollte, als ich erklären mußte, daß Keiner, durchaus Keiner, mich verstanden hätte. Sollte ich thun, als ob Sie gar nicht da wären, und nicht geschrieben hätten? Hinterher sehe ich freilich ein, daß dies das beste gewesen wäre; aber, lieber Schelling, ich kannte damals Ihre reizbare Em[p]findlichkeit, und die wahren [/] Gesinnungen, die man Ihnen – unaustilgbar, wie es scheint – gegen mich beigebracht hatte, noch nicht. Es war später, da Sie mich damit bekannt machten. Ich hielt in der That, diese Weise, die Sache zu behandeln, für die freundschaftlichste. – Daß Sie in Ihrem transscendentalen Idealismus (dies war Ihre damalige neueste Schrift, die in meinen Händen war) transscendentalen Idealismus – den einzig möglichen nemlich, der in Kants, und in meinen Schriften vor den Augen der Welt lag – darstellen wollten, muste ich freilich glauben, und daß Sie diesen nicht gefaßt hatten – auch noch nicht gefaßt haben, und auf dem Wege, den Sie einschlagen, nimmermehr fassen werden – lag am Tage. – „Ich hätte zu der Zeit, da ich dieses vor dem Publikum sagte, für mich gewußt, daß Sie einen ganz andern Zwek hätten, denn ich[“]? Lieber, seit wenn soll ich dies denn eigentlich wissen? Sie versichern ja sogar in der Einleitung zu Ihrer neuen Darstellung, ja Sie versichern selbst in dem Briefe, in dem die obigen Worte stehen, daß wir doch bei Einem Punkte zusammenkommen würden.
Nun wollen Sie mich sogar für Nicolaitische Deutungen verantwortlich machen! Es wird den Nicolaiten ein grosses Fest bereiten, wenn sie sehen, daß ihnen ihre Absicht gelungen sey.
Es dürften doch wohl noch andere Gründe denkbar seyn, warum ich unsre Differenz nicht gern öffentlich zur Sprache kommen lassen wollte; ausser dem, daß ich hätte abwarten wollen, bis es mir gelegen sey, sie zur Sprache zu bringen. Ich hoffte, Sie würden sich besinnen – ich gestehe, daß ich dasselbe noch hoffe – und so würde das Aergerniß, und die Verwirrung, die aus einem öffentlichen Streite zwischen uns ohne Zweifel entstehen würde, vermieden werden, und ein eminenter [/] Kopf, wie Sie, dem was ich für die gute Sache halte, erhalten werden können. Uebrigens habe ich nie gemeint, daß Sie etwa aus Freundschaft oder Schonung für mich etwas unterlassen sollten, was Sie zu thun Lust hätten. Ich für meine Person bin fest entschlossen, Ihrer durchaus nicht öffentlich zu erwähnen, bis entweder unsre Differenzen gehoben sind, falls sie gehoben werden können, oder Sie durch einen Angriff mich dazu nöthigen; und im leztern Falle versteht sich, daß ich mich meiner Achtung für Ihr Talent, und unsern ehemaligen freundschaftlichen Verhältnissen gemäß benehmen werde.
Es würde mir sehr erwünscht seyn, die Correspondenz mit Ihnen fortzusetzen; doch nur unter der Bedingung, wenn Sie sich persönlicher Beleidigungen enthalten wollen. Sie werden nicht wollen, daß ich bei Erblikung Ihrer Hand, und Ihres Siegels, die ehemals mir Freude machten, auf Bitterkeiten gefaßt seyn, und gegen sie mich waffnen soll.
Fichte.
Es ist sehr wahr, daß durch Einen Brief es sich kaum bis zur Ueberzeugung wird erheben lassen, welcher von uns beiden es sey, der sich in erheblichen Irrthümern und Vorurtheilen befinde, und – denn dies würde der Fall seyn – flach philosophire. Die Wahrheiten, die Sie in Ihrem leztern vortragen, sind auch mir sehr wohl bekannt; alle Ihre Erklärungen über mich aber, und meine Meinungen gründen sich auf Verkennung und Herabsetzung meines StandPunktes.
Unsern DifferenzPunkt kann ich Ihnen mit wenigen Worten angeben. – „Das absolute“ (über welches, und dessen Bestimmung ich mit Ihnen völlig einverstanden bin, auch die Anschauung desselben seit langem besitze) „existirt unter der Form der quantitativen Differenz, behaupte ich in meiner Darstellung“ sagen Sie. Dies ist es freilich, was Sie behaupten; und gerade deswegen habe ich Ihr System irrig gefunden, und die Darstellung desselben – weil durch keine Folgerung, und Erörterung richtig werden kann, was im Princip nicht taugt – bei Seite gelegt. Eben so thut Spinoza, und überhaupt aller Dogmatismus, und dieses ist das πρωτον ψευδος [.] Das absolute wäre nicht das absolute, wenn es unter irgend einer Form existirte. Woher nun aber doch die Form – allerdings der Quantität, auch hierüber bin ich mit Ihnen einverstanden – unter der es erscheint, komme, wo eigentlich diese Form einheimisch sey – oder auch, wie denn das Eine erst zu einem Unendlichen, und dann zu einer Totalität des Mannigfaltigen werde, das ist die Frage, welche die bis zu Ende gekommene Spekulation zu lösen hat, und welche Sie, da Sie diese Form schon [/] am absoluten, und mit ihm zugleich finden, nothwendig ignoriren müssen. Hier nun, in einer Region sonach, die Sie durch Ihr neues System sich verschlossen haben, und die Ihnen, wie man erst nun mit Sicherheit sagen kann, nie bekannt war, liegt der Idealismus der Wissenschaftslehre, und der Kantische: keinesweges da tief unten, wo Sie ihn lociren.
Sollten Sie die Güte haben wollen, diesen Punkt, der Ihnen nicht entgehen kann, zu bedenken; und zugleich zu bedenken, wie es zuging, daß Sie ihn übersahen – (nemlich weil Sie an das Absolute unmittelbar mit Ihrem Denken gingen, ohne sich auf Ihr Denken, und daß es wohl nur dieses seyn möchte, was durch seine eignen immanenten Gesetze Ihnen unter der Hand das Absolute formirte, zu erinnern) – so würden Sie den wahren Idealismus bald kennen lernen, und einsehen, wie Sie mich fortdauernd misverstehen.
Ihr Schreiben hat noch einen zweiten Theil, dessen Berührung mir schmerzhaft ist. Wie kommt es doch, daß Sie sich nicht mittheilen können, ohne zu beleidigen, und daß Sie die Ihnen gegenüber so gern feige, und falsch denken mögen? Haben Sie doch die Güte, einmal aus meiner Lage heraus zu bedenken, wie ich in Absicht Ihrer mich verhalten sollte, als ich erklären mußte, daß Keiner, durchaus Keiner, mich verstanden hätte. Sollte ich thun, als ob Sie gar nicht da wären, und nicht geschrieben hätten? Hinterher sehe ich freilich ein, daß dies das beste gewesen wäre; aber, lieber Schelling, ich kannte damals Ihre reizbare Em[p]findlichkeit, und die wahren [/] Gesinnungen, die man Ihnen – unaustilgbar, wie es scheint – gegen mich beigebracht hatte, noch nicht. Es war später, da Sie mich damit bekannt machten. Ich hielt in der That, diese Weise, die Sache zu behandeln, für die freundschaftlichste. – Daß Sie in Ihrem transscendentalen Idealismus (dies war Ihre damalige neueste Schrift, die in meinen Händen war) transscendentalen Idealismus – den einzig möglichen nemlich, der in Kants, und in meinen Schriften vor den Augen der Welt lag – darstellen wollten, muste ich freilich glauben, und daß Sie diesen nicht gefaßt hatten – auch noch nicht gefaßt haben, und auf dem Wege, den Sie einschlagen, nimmermehr fassen werden – lag am Tage. – „Ich hätte zu der Zeit, da ich dieses vor dem Publikum sagte, für mich gewußt, daß Sie einen ganz andern Zwek hätten, denn ich[“]? Lieber, seit wenn soll ich dies denn eigentlich wissen? Sie versichern ja sogar in der Einleitung zu Ihrer neuen Darstellung, ja Sie versichern selbst in dem Briefe, in dem die obigen Worte stehen, daß wir doch bei Einem Punkte zusammenkommen würden.
Nun wollen Sie mich sogar für Nicolaitische Deutungen verantwortlich machen! Es wird den Nicolaiten ein grosses Fest bereiten, wenn sie sehen, daß ihnen ihre Absicht gelungen sey.
Es dürften doch wohl noch andere Gründe denkbar seyn, warum ich unsre Differenz nicht gern öffentlich zur Sprache kommen lassen wollte; ausser dem, daß ich hätte abwarten wollen, bis es mir gelegen sey, sie zur Sprache zu bringen. Ich hoffte, Sie würden sich besinnen – ich gestehe, daß ich dasselbe noch hoffe – und so würde das Aergerniß, und die Verwirrung, die aus einem öffentlichen Streite zwischen uns ohne Zweifel entstehen würde, vermieden werden, und ein eminenter [/] Kopf, wie Sie, dem was ich für die gute Sache halte, erhalten werden können. Uebrigens habe ich nie gemeint, daß Sie etwa aus Freundschaft oder Schonung für mich etwas unterlassen sollten, was Sie zu thun Lust hätten. Ich für meine Person bin fest entschlossen, Ihrer durchaus nicht öffentlich zu erwähnen, bis entweder unsre Differenzen gehoben sind, falls sie gehoben werden können, oder Sie durch einen Angriff mich dazu nöthigen; und im leztern Falle versteht sich, daß ich mich meiner Achtung für Ihr Talent, und unsern ehemaligen freundschaftlichen Verhältnissen gemäß benehmen werde.
Es würde mir sehr erwünscht seyn, die Correspondenz mit Ihnen fortzusetzen; doch nur unter der Bedingung, wenn Sie sich persönlicher Beleidigungen enthalten wollen. Sie werden nicht wollen, daß ich bei Erblikung Ihrer Hand, und Ihres Siegels, die ehemals mir Freude machten, auf Bitterkeiten gefaßt seyn, und gegen sie mich waffnen soll.
Fichte.

